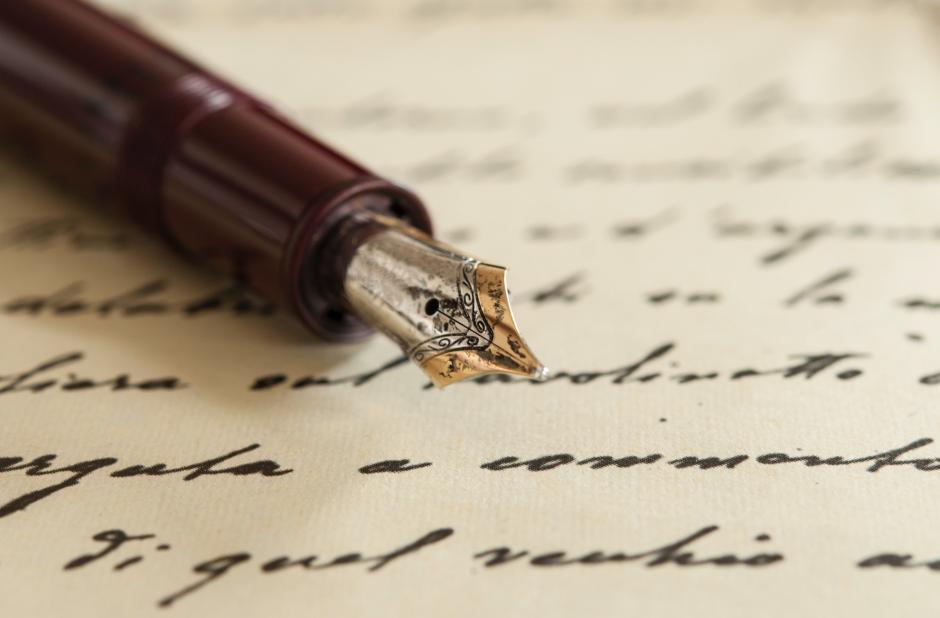
20. Oktober 2022Newsletter
Newsletter #3 10/2022 Die Erbrechtsrevision – was ändert sich per 1. Januar 2023?
Philippe Frésard und Philip Laternser gehen den bevorstehenden wesentlichen Änderungen des Schweizer Erbrechts nach und analysieren, wie sich diese auf die Einzelnen auswirken werden.
Übersicht: Per 1. Januar 2023 tritt die erste Etappe der Erbrechtsrevision – die sogenannte «politische Etappe» – in Kraft (nachfolgend als «Erbrechtsrevision» bezeichnet). Der vorliegende Newsletter vermittelt eine Übersicht über anstehende Änderungen, die sich unter die nachfolgenden sechs Themenbereiche zusammenfassen lassen. Eine weitere mögliche Neuigkeit, die «Rente für faktische Lebenspartner», wurde im Rahmen der parlamentarischen Beratungen ersatzlos aus der Erbrechtsrevision gestrichen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für alle Geschlechter. Erster Themenbereich: Änderungen bei den Pflichtteilen Das schweizerische Erbrecht anerkennt in gewissen Konstellationen eine Quote des gesetzlichen Erbteils, die grundsätzlich nicht entzogen werden darf – den sogenannten Pflichtteil. Im Rahmen der Erbrechtsrevision wird der bisher geltende Pflichtteil der Eltern ersatzlos gestrichen. Ab dem 1. Januar 2023 besitzen also nur noch die Nachkommen und der überlebende Ehegatte/eingetragene Partner einen Pflichtteilsanspruch (Art. 470 Abs. 1 neuZGB). Für Nachkommen beträgt die Pflichtteilsquote neu ½ statt ¾ der gesetzlichen Erbquote. Für Ehegatten nach wie vor ½ der gesetzlichen Erbquote (Art. 471 neuZGB). Neu kann also über mindestens die Hälfte des Nachlassvermögens frei verfügt werden. Im Zusammenhang mit der Reduktion der Pflichtteile für die Nachkommen wird auch Art. 473 ZGB geändert: Gemäss Art. 473 ZGB können Erblasser heute z.B. ¼ ihres Nachlasses dem überlebenden Ehegatten und ¾ des Nachlasses den gemeinsamen Nachkommen zuweisen, wobei der Anteil der Nachkommen mit einer Nutzniessung zugunsten des überlebenden Ehepartners belastet werden kann. Die Erbrechtsreform erweitert den Spielraum der Ehegatten, indem die Quote, die sich die Ehegatten neben der Nutzniessung zuweisen können, von ¼ auf ½ erhöht wird (Art. 473 Abs 2 neuZGB). Das neue Pflichtteilsrecht findet auf bestehende Testamente und Erbverträge Anwendung, wenn der Erblasser nach dem 31. Dezember 2022 stirbt (Todestagsprinzip gemäss Art. 16 Abs. 3 SchlT ZGB). Wird im Testament oder Erbvertrag z.B. explizit ein altrechtlicher Nachkommenspflichtteil von ¾ der gesetzlichen Erbquote aufgeführt, ist es eine Auslegungsfrage, ob der Erblasser durch Bezugnahme auf den altrechtlichen Pflichtteil zum Ausdruck bringen wollte, dass die betreffende Person möglichst wenig erhalten soll (womit auf den neuen Pflichtteil abzustellen wäre) oder ob die Person im Umfang der tatsächlich angegebenen Quote begünstigt wurde. Deshalb sind bisherige Testamente und Erbverträge dahingehend zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund der Erbrechtsrevision noch dem tatsächlichen Willen der Parteien entsprechen oder andernfalls angepasst werden müssen. Zweiter Themenbereich: Beseitigung von Unsicherheiten in Bezug auf die Herabsetzungsobjekte und die Herabsetzungsreihenfolge Wenn der Pflichtteil durch Verfügungen von Todes wegen oder lebzeitige Zuwendungen des Erblassers verletzt wird, kann der betroffene Pflichtteilserbe verlangen, dass die Zuwendungen insoweit reduziert oder rückgängig gemacht werden, als der verletzte Pflichtteil wieder hergestellt oder «aufgefüllt» ist. Dieser Vorgang wird «Herabsetzung» genannt (vgl. Art. 522 ff. ZGB). Durch eine Neuformulierung von Art. 532 ZGB beseitigt die Erbrechtsrevision Unsicherheiten bei der Frage, welche Vermögensanfälle herabgesetzt werden können und in welcher Reihenfolge diese herabzusetzen sind. So erwähnt Art. 532 Abs. 1 neuZGB nunmehr ausdrücklich, dass nicht nur Zuwendungen von Todes wegen (z.B. ein Vermächtnis) oder lebzeitige Zuwendungen (z.B. eine Schenkung) sondern auch die Erwerbungen der gesetzlichen Erbfolge – an erster Stelle – herabgesetzt werden können, sofern Pflichtteile verletzt wurden (eine Herabsetzung der gesetzlichen Erbfolge fällt beispielsweise in Betracht, wenn der Erblasser die gesetzliche Erbfolge und gleichzeitig pflichtteilsverletzende Vermächtnisse anordnete). Weiter führt Art. 532 Abs. 2 neuZGB die ehevertraglichen Zuwendungen explizit bei den Zuwendungen unter Lebenden auf, womit der Lehrstreit geklärt wird, ob es sich bei ehegüterrechtlichen Zuwendungen um Zuwendungen unter Lebenden oder um Verfügungen von Todes wegen handelt. Relevant war dieser Lehrstreit bisher, weil zunächst die Zuwendungen von Todes wegen – an zweiter Stelle – und erst dann die Zuwendungen unter Lebenden – an dritter Stelle – herabgesetzt werden. Die Qualifizierung ehevertraglicher Zuwendungen als Zuwendungen unter Lebenden schützt mithin den überlebenden Ehepartner, weil die ehevertragliche Begünstigung im Fall einer Pflichtteilsverletzung erst in dritter Linie herabgesetzt wird. Dritter Themenbereich: Auswirkungen der Scheidung auf das Erbrecht Bisher trat der Erb- und Pflichtteilsverlust des Ehegatten erst mit formell rechtskräftigem Scheidungsurteil ein (Art. 120 Abs. 2 ZGB). Neu verliert der überlebende Ehegatte seinen Pflichtteilsschutz bereits dann, wenn beim Tod des Erblassers ein Scheidungsverfahren hängig ist und dieses Scheidungsverfahren auf gemeinsames Begehren eingeleitet wurde (Art. 111 ZGB) oder die Ehegatten mindestens zwei Jahre getrennt gelebt haben (Art. 472 Abs. 1 neuZGB). Aber Achtung: Mit der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens geht der Pflichtteilsanspruch, nicht das gesetzliche Erbrecht unter. Das heisst, dass das gesetzliche Erbrecht mittels einer Verfügung von Todes wegen – also z.B. mit einem Testament – entzogen werden muss. Zudem entfallen mit Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens alle Ansprüche aus Testamenten und Erbverträgen (Art. 120 Abs. 3 neuZGB), die ehevertragliche Begünstigung bei der Vorschlagsbeteiligung (Art. 217 Abs. 2 neuZGB) sowie die ehevertragliche Begünstigung bei der Gesamtgutszuweisung (Art. 241 Abs. 4 neuZGB), sofern nichts anderes vereinbart bzw. verfügt wurde. Vierter Themenbereich: Keine Berücksichtigung der überhälftigen Vorschlagszuteilung bei der Pflichtteilsberechnungsmasse Ehegatten, die sich auf ihren Tod hin ein- oder gegenseitig so weit wie möglich begünstigen wollen und dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung unterliegen, können sich ehevertraglich die Gesamtsumme beider Vorschläge zuweisen (Art. 216 Abs. 1 ZGB), was dazu führt, dass der überlebende Ehegatte grundsätzlich sämtliches Vermögen erhält, das die Ehegatten während der Ehe entgeltlich erworben haben – allem voran der gemeinsam angesparte Arbeitserwerb. Solche Vereinbarungen müssen die Pflichtteilsansprüche gemeinsamer Nachkommen nicht respektieren (Art. 216 Abs. 2 ZGB), weshalb sie in der Praxis weit verbreitet sind (sogenannte «Meistbegünstigungsklauseln»). Bisher existierte bei der Auslegung von Art. 216 Abs. 1 ZGB die Streitfrage, ob die ehevertragliche Begünstigung bei der Berechnung der Pflichtteile der gemeinsamen Nachkommen (im Gegensatz zu jenen der nichtgemeinsamen Nachkommen) nicht berücksichtigt wird (Auslegung 1) oder ob die ehevertragliche Begünstigung für die Berechnung der Pflichtteile aller Nachkommen berücksichtigt wird, die gemeinsamen Nachkommen die ehevertragliche Begünstigung aber (im Gegensatz zu den nichtgemeinsamen Nachkommen) nicht herabsetzen bzw. «angreifen» können (Auslegung 2). Auslegung 2 führt eher zu einer Verletzung der Pflichtteile gemeinsamer Nachkommen, was diese alsdann über allfälliges Eigengut des Erblassers (das heisst bereits in die Ehe eingebrachtes oder seither durch Erbschaften oder Schenkungen erworbenes Vermögen) zu Lasten des überlebenden Ehegatten korrigieren können. Deshalb legt Art. 216 Abs. 2 neuZGB ausdrücklich fest, dass die ehevertragliche Zuweisung bei der Berechnung der Pflichtteile des überlebenden Ehegatten, der gemeinsamen Kinder und deren Nachkommen nicht hinzugerechnet wird. Damit will der Gesetzgeber dem Bedürfnis nach einer maximalen Begünstigung des überlebenden Ehegatten gerecht werden. Fünfter Themenbereich: Begründung eines Verfügungsverbots nach Abschluss eines Erbvertrags Gemäss aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Zuwendungen nach dem Abschluss eines Erbvertrags erlaubt, sofern im Erbvertrag nicht etwas anderes vorgesehen ist und der Erblasser nicht offensichtlich beabsichtigt, seine Verpflichtungen aus dem Erbvertrag auszuhöhlen oder den Erbvertragsbegünstigten zu schädigen (BGE 140 III 193). Damit statuierte das Bundesgericht eine grundsätzliche Verfügungsfreiheit nach Abschluss eines Erbvertrags, sofern darin kein einschlägiges Verbot enthalten ist oder die Verfügungen rechtsmissbräuchlich sind. In der Lehre traf der vorgenannte Entscheid des Bundesgerichts weitgehend auf Ablehnung, so dass der Gesetzgeber Art. 494 ZGB dahingehend umformuliert hat, dass nach Abschluss eines Erbvertrags ein grundsätzliches Verfügungsverbot besteht, sofern der Erbvertrag keinen ausdrücklichen Zuwendungsvorbehalt enthält. Konkret statuiert Art. 494 Abs 3 neuZGB, dass Verfügungen von Todes wegen und Zuwendungen unter Lebenden der Anfechtung unterliegen, sofern sie die erbvertraglichen Begünstigungen schmälern und im Erbvertrag nicht vorbehalten worden sind. Aufgrund des Todestagsprinzips von Art. 16 Abs. 3 SchlT ZGB findet die neue Regelung auch auf bisherige Erbverträge und seither ausgerichtete Zuwendungen Anwendung, wenn der Erblasser nach dem 31. Dezember 2022 stirbt. Ob Schenkungen und/oder Verfügungen von Todes wegen nach Abschluss eines Erbvertrags erlaubt sind, ist von erheblicher praktischer Bedeutung. Deshalb ist auch hier zu prüfen, ob der Wille der Parteien in bestehenden Erbverträgen vor dem Hintergrund des neuen Rechts richtig wiedergegeben wird oder ob der Erbvertrag (wenn möglich) anzupassen ist. Sechster Themenbereich: Klarstellung bei der gebundenen Selbstvorsorge Bisher wurden die Vorsorgevereinbarung (Säule 3a als Banksparen) und die Vorsorgeversicherung (Säule 3a als Vorsorgeversicherung) aus erbrechtlicher Sicht unterschiedlich behandelt: Während das Guthaben aus der Vorsorgevereinbarung wie freies Vermögen in den Nachlass fiel, floss das Guthaben aus der Vorsorgeversicherung am Nachlass vorbei, weil die Begünstigten gegenüber der Vorsorgeversicherung bereits einen direkten Anspruch besassen (Art. 78 VVG). Ab dem 1. Januar 2023 fallen weder die Guthaben aus der Vorsorgevereinbarung noch die Guthaben aus der Vorsorgeversicherung in den Nachlass. Neu besitzen die Begünstigten bei beiden Vorsorgelösungen einen eigenen Anspruch gegenüber der Bank oder Versicherung, so dass die Guthaben den Begünstigten direkt ausbezahlt werden müssen (Art. 82 Abs. 4 neuBVG). Zu berücksichtigen ist, dass ein allfälliger Rückkaufswert der Vorsorgeversicherung sowie das Kapital beim Banksparen zur Pflichtteilsberechnungsmasse hinzugezählt wird und gegebenenfalls herabsetzbar ist (Art. 476 und 529 neuZGB). Fazit In Bezug auf die Pflichtteile bringt die Erbrechtsrevision für den Erblasser mehr Flexibilität, was insbesondere für Nachfolgelösungen bei Familienunternehmen begrüssenswert ist. Dabei ist festzuhalten, dass die Unternehmensnachfolge im Rahmen des nun anstehenden zweiten Teils der Revision durch zusätzliche Massnahmen erleichtert wird. Allerdings könnten benachteiligte Erben versucht sein, ihre Pflichtteile wertmässig zu vergrössern, indem sie Handlungen des Erblassers, die einen Einfluss auf die Pflichtteilsberechnungsmasse haben (wie z.B. lebzeitige Schenkungen) oder die Bewertung von Nachlassgegenständen anfechten. Betreffend Zuwachs an Flexibilität ist weiter zu berücksichtigen, dass die Erbrechtsrevision keinen Einfluss auf die Erbschaftssteuern nimmt. Insbesondere bei der Begünstigung von Nichtverwandten können je nach Kanton hohe Steuerfolgen resultieren. Bei Testamenten und Erbverträgen, die vor dem 1. Januar 2023 errichtet wurden, muss geprüft werden, ob die Höhe des Nachkommenspflichtteils (¾ oder ½ der gesetzlichen Erbquote) klar hervorgeht und das Ergebnis der Prüfung dem tatsächlichen Willen der verfügenden Partei entspricht. Bei Erbverträgen ist im Speziellen zu prüfen, ob der tatsächliche Wille der Parteien nach dem Wechsel von einer grundsätzlichen Verfügungsfreiheit zu einem grundsätzlichen Verfügungsverbot noch richtig wiedergegeben wird. Der Verlust des Pflichtteilsanspruchs nach rechtshängiger Scheidung dient der Vermeidung taktischer Verzögerungen im Scheidungsverfahren. Nach Einreichung des Scheidungsbegehrens dürfen die Ehegatten aber nicht untätig bleiben, sondern müssen das gesetzliche Erbrecht des andern Ehegatten mittels Verfügung von Todes wegen entziehen. Im Übrigen schafft die Erbrechtsrevision Klarheit bei Auslegungsfragen, wobei sie insbesondere den Parteien eines Ehevertrags hinsichtlich einer angestrebten Meistbegünstigung mehr Sicherheit vermittelt. Für Ihre Nachlassplanung – inklusive Überprüfung Ihrer bisherigen Testamente und Erbverträge – stehen Ihnen unsere Spezialisten sehr gerne zur Verfügung. Bern, im Oktober 2022 Newsletter Erbsrechtsrevision - DeutschKontakte Philippe FrésardTel. +41 58 200 35 66 Fax +41 58 200 35 11 philippe.fresard@kellerhals-carrard.ch  Dr. Philip LaternserTel. +41 58 200 35 53 Fax +41 58 200 35 11 philip.laternser@kellerhals-carrard.ch  PD Dr. Dario AmmannTel. +41 58 200 30 67 Fax +41 58 200 30 11 dario.ammann@kellerhals-carrard.ch  Dr. Marco BalmelliTel. +41 58 200 30 00 Fax +41 58 200 30 11 marco.balmelli@kellerhals-carrard.ch  Nicolas GillardTel. +41582003308 Fax +41582003311 nicolas.gillard@kellerhals-carrard.ch  Ingrid IselinTel. +41 58 200 32 00 Fax +41 58 200 32 11 ingrid.iselin@kellerhals-carrard.ch  Peter SchatzTel. +41 58 200 39 03 peter.schatz@kellerhals-carrard.ch  Prof. Dr. Annette SpycherTel. +41 58 200 35 42 Fax +41 58 200 35 11 annette.spycher@kellerhals-carrard.ch  Giovanni StucchiTel. +41 58 200 31 00 Fax +41 58 200 31 11 giovanni.stucchi@kellerhals-carrard.ch |