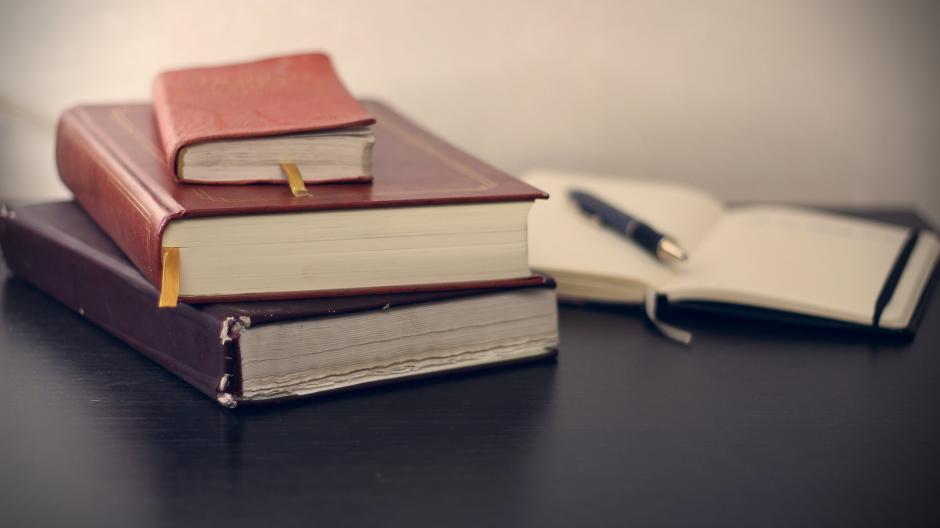Einleitung
Am 12. Dezember 2017 wurde die Initiative „Stopp der Hochpreisinsel – für faire Preise" (auch bekannt als „Fair-Preis-Initiative") eingereicht. Die Initiative zielte darauf ab, Nachfragern aus der Schweiz den Einkauf im Ausland zu den dort geltenden (in der Regel tieferen) Preisen zu ermöglichen. Der Bundesrat hatte in der Folge einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative ausgearbeitet, der vom Parlament allerdings derart stark angepasst wurde, dass die Fair-Preis-Initiative praktisch 1:1 auf dem Gesetzesweg umgesetzt wird.
Das Parlament hat den angepassten Gegenvorschlag in der Schlussabstimmung vom 19. März 2021 angenommen und damit das Konzept der relativen Marktmacht in das Kartellgesetz (KG) eingeführt. Das Missbrauchsverbot für marktbeherrschende Unternehmen von Art. 7 KG wird neu auf relativ marktmächtige Unternehmen ausgedehnt, wobei diese Unternehmen von den direkten Sanktionen gemäss Art. 49a KG ausgenommen sind. Weiter gilt die Beschränkung der Bezugsmöglichkeit von im In- und Ausland erhältlichen Waren im Ausland zu den dortigen Preisen und Bedingungen neu als missbräuchliche Verhaltensweise. Schliesslich wird durch eine Anpassung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) das private Geoblocking im Online-Handel verboten.
Die neuen Regelungen werden vorbehaltlich eines (unwahrscheinlichen) Referendums voraussichtlich per 1. Januar 2022 in Kraft treten.
Relative Marktmacht
Gemäss Wortlaut des neuen Art. 4 Abs. 2bis KG gilt als relativ marktmächtig ein „Unternehmen, von dem andere Unternehmen beim Angebot oder bei der Nachfrage einer Ware oder Leistung in einer Weise abhängig sind, dass keine ausreichenden und zumutbaren Möglichkeiten bestehen, auf andere Unternehmen auszuweichen".
Für das Vorliegen einer relativ marktmächtigen Stellung sind also – im Gegensatz zur klassischen Marktbeherrschung (Art. 4 Abs. 2 KG) – nicht die Marktstrukturdaten wie etwa die Höhe und Verteilung von Marktanteilen relevant. Vielmehr ist ausschliesslich auf das Fehlen von ausreichenden und zumutbaren Ausweichmöglichkeiten bzw. auf das „individuell-vertikale Abhängigkeitsverhältnis" zwischen einem Unternehmen und dessen (potentiellen) Geschäftspartner (Abnehmer oder Lieferant) abzustellen (siehe ausführlich dazu: STÄUBLE/SCHRANER, DIKE-KG, Art. 4 Abs. 2 N 119 und 153). Dementsprechend können neu auch Unternehmen mit einem niedrigen Marktanteil als relativ marktmächtig qualifiziert und damit der Missbrauchsaufsicht von Art. 7 KG unterstellt werden.
Da die relative Marktmacht immer nur in Bezug auf einen konkreten Geschäftspartner und auf eine spezifische Ware oder Dienstleistung eines Unternehmens bestehen kann, hat die Beurteilung jeweils einzelfallweise zu erfolgen. Dies erhöht die Komplexität der Kartellrechts-Compliance. So ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob für den Abnehmer bzw. Lieferanten Ausweichmöglichkeiten in Form von objektiv gleichwertigen Bezugs- bzw. Lieferquellen vorhanden sind. Allfällige Ausweichmöglichkeiten müssen für den Abnehmer bzw. Lieferanten – unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten – zumutbar sein, d.h. die Umstellung auf das andere Unternehmen darf ihn nicht wesentlich in seiner Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Eine vom Geschäftspartner „selbstverschuldete" Abhängigkeit sollte indes keinen Schutz verdienen. In einem zweiten Schritt sollte deshalb geprüft werden, ob der Geschäftspartner seine Abhängigkeit vom Unternehmen bspw. durch einen strategischen Fehlentscheid selbstverschuldet hat. Werden beide Prüfschritte verneint, folgt daraus die relativ marktmächtige Stellung des Unternehmens. Das Unternehmen hat entsprechend das Missbrauchsverbot nach Art. 7 KG zu beachten und darf gegen ein abhängiges Unternehmen ohne sachlichen Rechtfertigungsgrund keine Liefer- oder Bezugssperren verhängen oder dieses bei Preisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen gegenüber den anderen Unternehmen ungleich behandeln. Individuelle Preisverhandlungen werden unzulässig bzw. Rabatte sind nur noch dann erlaubt, wenn entsprechende Kosteneinsparungen nachgewiesen werden können. Dadurch wird die Vertragsfreiheit des relativ marktmächtigen Unternehmens spürbar eingeschränkt.
Im Gegensatz zum missbräuchlichen Verhalten eines marktbeherrschenden Unternehmens kann beim Missbrauch einer relativ marktmächtigen Stellung keine direkte Sanktion nach Art. 49a KG verhängt werden. Das abhängige Unternehmen hat seine allfälligen Ansprüche (Beseitigung oder Unterlassung der Wettbewerbsbehinderung, Schadenersatzansprüche und Gewinnherausgabe) grundsätzlich auf dem Zivilweg geltend zu machen. Verträge, welche gegen die neuen Bestimmungen verstossen, sind ganz oder teilweise nichtig. Entsprechend ist die Durchsetzung vertraglich stipulierter Forderungen gegenüber strukturell abhängigen Unternehmen unsicherer geworden.
Die WEKO beabsichtigt, nach Inkrafttreten der neuen Regelungen rasch Leitentscheide zu fällen und Fallgruppen zu schaffen. Grundsätzlich sind die Ansprüche aber vor den Zivilgerichten geltend zu machen, da es sich im Regelfall um bilaterale Auseinandersetzungen handelt, welche den Einsatz der Ressourcen der Wettbewerbsbehörden nicht rechtfertigen.
Bei der Bildung von Fallgruppen dürfte sich die WEKO an die deutsche Rechtspraxis zum Konzept der relativen Marktmacht anlehnen. In Deutschland haben sich bislang insbesondere folgende Fallgruppen herausgebildet:
- Sortimentsbedingte Abhängigkeit: Ein Händler ist auf die Führung spezifischer Produkte in seinem Sortiment angewiesen, um wettbewerbsfähig zu sein („Must-in-Stock-Problematik").
- Unternehmensbedingte Abhängigkeit: Ein Unternehmen (z.B. Vertragshändler) ist von einem anderen Unternehmen aufgrund spezifischer Ausrichtung seines Geschäftsbetriebs bzw. entsprechender Investitionen abhängig („Lock-in-Effekt").
- Nachfragebedingte Abhängigkeit: Ein Anbieter ist mangels ausreichender und zumutbarer alternativen Absatzkanälen von einem bestimmten Nachfrager abhängig.
Recht zum Kauf im Ausland zu lokalen Preisen und Bedingungen
Mit dem neuen Art. 7 Abs. 2 lit. g KG wird der Beispielkatalog um einen Tatbestand erweitert, wonach es missbräuchlich ist, die Möglichkeit der Nachfrager, Waren oder Leistungen, die in der Schweiz und im Ausland angeboten werden, im Ausland zu den dortigen Preisen und Geschäftsbedingungen zu beziehen, einzuschränken. Diese Bestimmung betrifft insbesondere internationale Konzerne, welche in der Schweiz in Form von Tochtergesellschaften eigene Vertriebsstrukturen aufgebaut haben. Es sollen Lieferweigerungen und Preis-Diskriminierungen durch relativ marktmächtige bzw. marktbeherrschende Anbieter im Ausland adressiert werden. Sachliche Gründe, die eine entsprechende Verhaltensweise rechtfertigen können, bleiben vorbehalten. Falls Waren oder Leistungen ausschliesslich in der Schweiz und nicht auch im Ausland angeboten werden, kommt der neue Art. 7 Abs. 2 lit. g KG hingegen nicht zur Anwendung.
Verbot von Geoblocking
Im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) wurde mit Art. 3a Abs. 1 lit. a eine Bestimmung über die Diskriminierung im Fern- bzw. Online-Handel eingeführt. Demnach liegt eine Diskriminierung vor, wenn ein Kunde in der Schweiz aufgrund seiner Nationalität, seines Wohnsitzes, dem Ort seiner Niederlassung, des Sitzes seines Zahlungsdienstleisters oder des Ausgabeorts seines Zahlungsmittels beim Preis oder bei den Zahlungsbedingungen diskriminiert wird. Weiter liegt eine Diskriminierung vor, wenn dem Kunden der Zugang zu einem Online-Portal blockiert bzw. beschränkt wird oder der Kunde ohne sein Einverständnis zu einer anderen als der ursprünglich aufgesuchten Version des Online-Portals weitergeleitet wird. Damit soll es natürlichen wie juristischen Personen ermöglicht werden, online zu den im jeweiligen Land praktizierten Preiskonditionen einzukaufen.
Konsequenzen
Die Einführung der relativen Marktmacht hat für viele Schweizer Unternehmen, insbesondere auch (spezialisierte) KMU, zur Folge, dass neu für jede bestehende sowie potentielle Geschäftsbeziehung einzeln zu prüfen sein wird, ob mangels ausreichender und/oder zumutbarer Ausweichmöglichkeiten ein kartellrechtlich relevantes Abhängigkeitsverhältnis besteht, welches eine relativ marktmächtige Stellung und damit die Anwendbarkeit der Missbrauchskontrolle nach Art. 7 KG begründet. Ist dies der Fall, so ist die betreffende Geschäftsbeziehung bzw. die Ausgestaltung der Konditionen auf einen allfälligen Anpassungsbedarf hin zu überprüfen. Bei der Selbst-Beurteilung der Marktstellung können sich die Unternehmen – bis zur Publikation der ersten Leitentscheiden der WEKO – immerhin auf die bereits etablierte Praxis der deutschen Gerichtsbehörden stützen, die verschiedene Fallgruppen und entsprechende Beurteilungskriterien zur relativen Marktmacht entwickelt haben.
Alternativ können sich die Unternehmen natürlich auch „freiwillig" dem Regime von Art. 7 KG unterwerfen und insbesondere darauf verzichten, ihre Geschäftspartner bei Preisen und Konditionen unterschiedlich zu behandeln – eine Massnahme, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht freilich wenig sinnvoll erscheint.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.